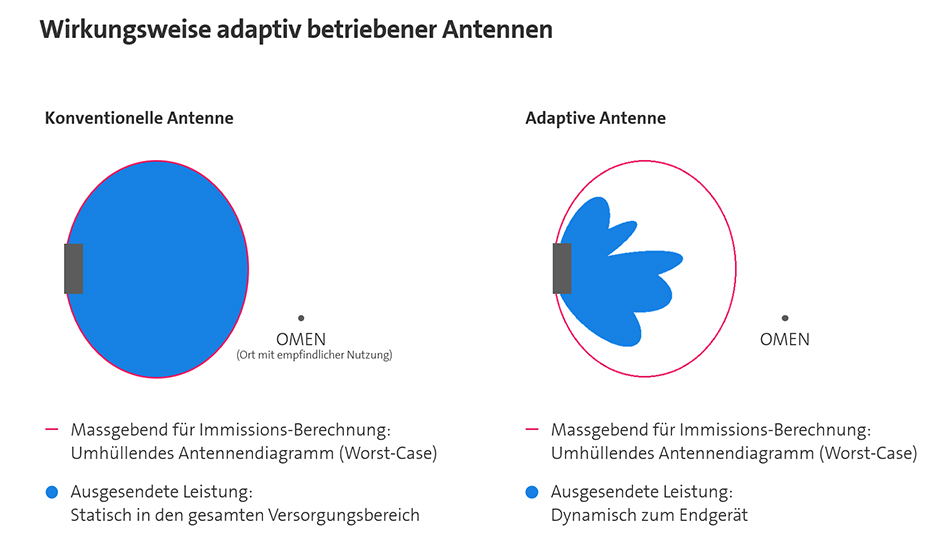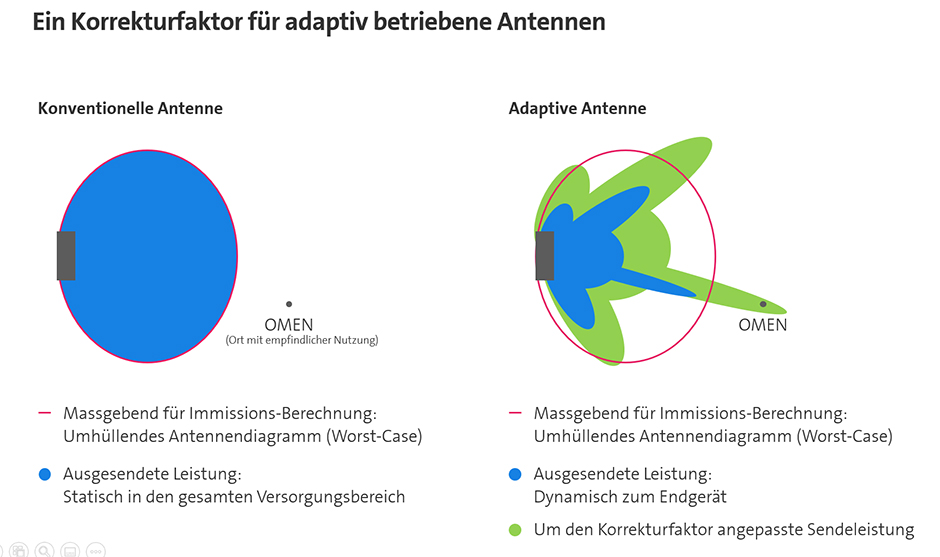Nochmals zurück zu den sehr kurzzeitigen Leistungsspitzen von adaptiven Antennen. Kritiker sehen darin eine massive Aufweichung der sehr strengen Schweizer Vorsorgewerte. Der Physiker rechnet uns vor: Die theoretische Höchstexposition von einer von uns eingesetzten adaptiven Antenne beträgt knapp 19 Volt pro Meter. In der Realität kommt das aber nicht vor und selbst die viel niedrigeren Leistungsspitzen fallen höchstens im Zeitraum von wenigen Sekundenbruchteilen bis max. Sekunden an.
Ist es nun im Interesse eines Netzbetreibers, diese theoretische Höchstleistung überhaupt auszureizen? Nein, natürlich nicht. Denn in diesem Fall dürfte die Antenne während bloss 36 Sekunden voll senden, müsste dann aber ganze 5 Minuten und 24 Sekunden die Leistung komplett ausschalten, damit der 6-minütige Mittelwert eingehalten werden kann.
Man stelle sich das am HB Zürich vor: 36 Sekunden beste Datenverbindung, dann jedoch 5 Minuten und 24 Sekunden komplette Sendepause für hunderte Nutzer? Gespräche würden dann ebenso nach 36 Sekunden abgebrochen. Der Betreiber ist aus praktischen Gründen daran interessiert, Leistungen möglichst gleichmässig zu verteilen. Die 19 Volt pro Meter bleiben hypothetisch und sie sind weit davon entfernt, die geltenden Grenzwerte aufzuweichen.